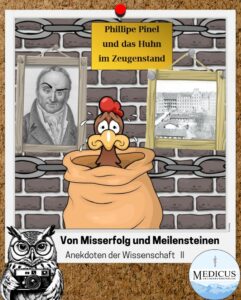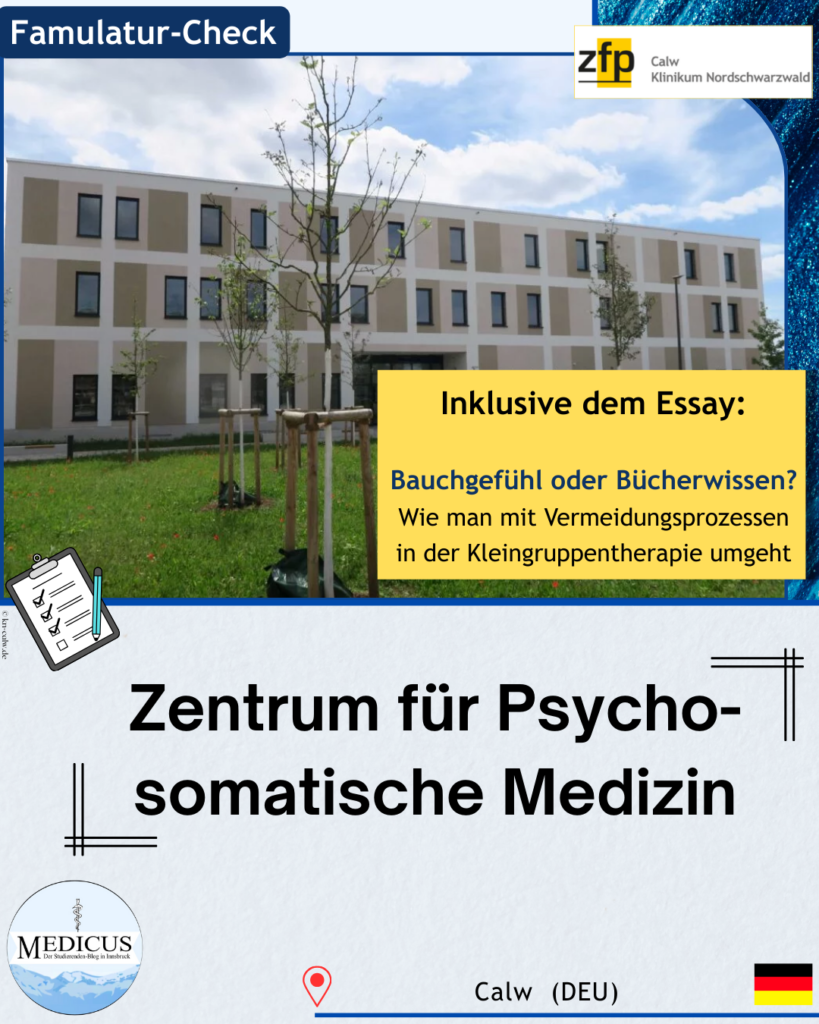
Zentrum für Psychosomatische Medizin – Calw (DEU) & Bauchgefühl oder Bücherwissen bei Vermeidungsprozessen in der Kleingruppentherapie
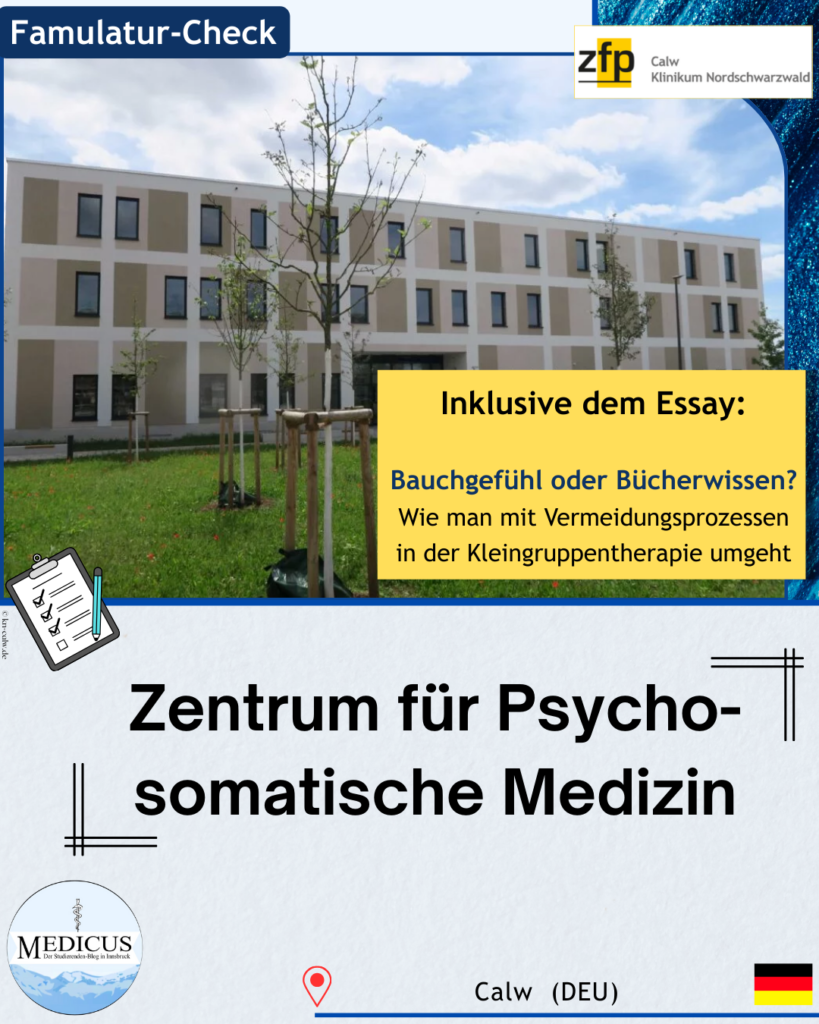
Meine Famulatur am Zentrum für Psychosomatische Medizin in Calw (Deutschland) war für mich eine besonders bereichernde Zeit. Dort hatte ich sowohl psychologisch (als studierter Psychologe) und medizinisch als Famulant gearbeitet. Meiner Meinung nach sollte man als angehender Mediziner zumindest einmal eine Kurzfamulatur in einer psychologischen Einrichtung (Ambulanz, Geschlossene, Offene, Psychosomatik, auch Sucht) verbringen, um ein Gespür dafür zu bekommen, wie unterschiedlich es ist, Störungen mal nicht „sehen“ zu können. Die Bewerbung für die Famulatur funktionierte ganz unkompliziert per E-Mail.
Der Schwerpunkt in Calw liegt auf psychosomatischen Erkrankungen, bei denen einerseits seelische Belastungen körperliche Beschwerden wie Verdauungsprobleme, Schmerzen, Herzbeschwerden oder Tinnitus auslösen können. Anderseits begegnet man vielen Menschen mit Panikattacken, Depressionen oder Ängsten, die sich freiwillig stationär haben aufnehmen lassen, weil sie aktiv etwas verändern möchten.
Man beginnt den Tag offiziell um 8 Uhr mit der Morgenbesprechung, und auf Pünktlichkeit wird sehr großen Wert gelegt.
Das Angebot in der Klinik ist breit gefächert und umfasst u.a. Gruppentherapie (2x/Woche), Einzeltherapie (2x/Woche), Ergotherapie, Kunsttherapie, Muskelentspannungstraining, eine Art Gartenverein, Kochstunden, Nordic Walking, DBT, psychoedukative Maßnahmen und soziale Kompetenzgruppen, in der – wie der Name es schon vermuten lässt – soziale Kompetenzen vermittelt werden.
Als Famulant wird man in Calw keineswegs als lästiges Übel betrachtet, sondern von Anfang an ins Team eingebunden und als medizinischer Student ernstgenommen. Man ist nicht bloß stiller Beobachter, sondern kann tatsächlich eine wertvolle Hilfe sein. Meine medizinischen Tätigkeiten umfassten dabei:
- Die Teilnahme an Vorstellungs-, Aufnahmegesprächen, allgemeinmedizinischen Visiten und Abklärungen, sowie Besprechungen zur Medikamentengabe und Neueinstellung
- Die eigenständige medizinische Aufnahme: Das Erheben der systematischen Anamnese (u.a. Beschwerdebild, Symptome, Lebenssituation, Therapieerfahrung, subjektives Krankheitsverständnis, Medikamentenanamnese, Beurteilung des Allgemein- und Ernährungszustandes), sowie des allgemeinmedizinischen und kardiologischen Basisstatus
- Weiters die Teilnahme an multiprofessionellen Teamsitzungen im Bereich der Psychosomatik
Das Pflegepersonal ist sehr aufmerksam und geduldig. Ein multiprofessionelles Therapeutenteam (aus Ärzten, Psychologen und weiteren Therapeuten) bemüht sich intensiv darum, jedem Patienten in den Behandlungen gerecht zu werden. So wird zum Beispiel in mehrmals wöchentlich stattfindenden Meetings des Stationsteams jeder Patient besprochen, und zwar aus den unterschiedlichen Blickwinkeln der verschiedenen Mitarbeiter. Das kommt jedem zugute!
Eines ist mir übrigens nach meiner Famulatur besonders im Kopf geblieben: Die Gruppenpsychologie.

Bauchgefühl oder Bücherwissen bei Vermeidungsprozessen in der Kleingruppentherapie
Eine Bühne voller Beziehungen
Wer einmal eine Gruppentherapie von innen erlebt hat – sei es als Patient, Therapeut oder nur als Beobachter – weiß, dass sich dort eine eigene Welt entwickelt. Das Ganze ist wie so ein Mikrokosmos aus Beziehungen, Blickverhalten, leisen sowie lauten Worten, und natürlich Missverständnissen.
Rein theoretisch müssten wir ja annehmen, dass sich in der Gruppentherapie alle Beteiligten um maximale Offenheit bemühen. Doch das ist nicht selbstverständlich! Die Offenheit eines Patienten in einer Gruppe hängt stark von persönlichen Faktoren ab – besonders von den „großen Drei“: Alter, Beziehungsstatus und Beruf. Diese drei Charakteristika verraten bereits viel über die Lebenssituation einer Person und beeinflussen auch, wie sie innerhalb einer Gruppe auftritt. Also ob ein Patient offen spricht, sich eher zurückhält oder ständig ambivalent zwischen beiden Polen schwankt.
Immer wieder stellten sich die Patienten folgende Kernfrage: „Wie können Eltern so sein?“ Hinter dieser Frage steckt nicht nur die Konfrontation mit der eigenen Biografie, sondern auch das Umgehen mit falschen Attributionen. Lass mich ein Beispiel nennen: Stell Dir ein junges Kind vor, auf seiner Geburtstagsfeier. Alle lächeln das Kind an, alle schenken etwas, alle freuen sich über seine Anwesenheit! So viel Glück, da bleibt dem Kind ja praktisch nur eine Interpretation übrig, um diese Zustände der anderen zu verstehen: Ich bin einfach toll!
Wenn Jahre später in der Therapie etwas anderes geschieht… vielleicht ist es nur ein kleiner nonverbaler Moment… etwa, wenn der Therapeut im intensiven Dialog kurz aus dem Fenster schaut… kann der traumatisierte Patient genau dies bereits als „Kriegserklärung“ deuten: Wie hoch ist die Langweile des Therapeuten mir gegenüber? Oder sein Desinteresse? Ja, warum wertet er mich ab? So fragil kann die Wahrnehmung für den Patienten sein. Das ist keinesfalls übertrieben.
Und dennoch: Obwohl traumatische Erfahrungen sehr belastend sind, entwickeln etwa 70 % der Betroffenen keine psychische Erkrankung danach. Ob jemand stabil bleibt oder doch erkrankt, hängt von verschiedenen Faktoren ab; darunter fallen Persönlichkeit, innere Ressourcen und soziale Unterstützung.
Für die Therapie ist dabei eine zentrale Frage: Welche inneren Vorstellungen von Beziehungen und Beziehungsgestaltung bringen die Patienten mit?
Kommen die Patienten in die Gruppe wie ein Spion ins Feindesland, stets wachsam, umgeben von vermeintlichen Feinden? Da müssen wir ja schon fast an Karl May denken: „Die Reiter atmeten erleichtert auf, als sie ins Freie gelangten, welches sie freilich nicht eher betraten, als bis sie vorsichtig Umschau gehalten hatten, ob keine feindlichen Wesen in der Nähe seien.“ Jederzeit kann es im Gebüsch knacken, jederzeit kann die Deckung gesprengt werden!
Auch für uns Therapeuten ist es in einer Gruppentherapie manchmal schwierig. Wir spüren ebenfalls die Spannungen, die Unsicherheit. Deshalb arbeiten wir nicht immer nur nach festen Regeln, sondern mischen Methoden: Manchmal folgen wir streng den Skripten, der evidenzbasierten psychotherapeutischen Medizin, oder den Vorgaben aus Lehrbüchern. Aber nicht selten tun wir dies aber auch, weil wir Angst haben, die Gruppe könnte zerfallen oder es könnte etwas Unvorhergesehenes passieren. Die Gruppe zwingt uns, klare Vorgaben suchen – einfach, um Sicherheit und Halt zu haben. Das ist wie ein Geländer, oder eine Leiter, an der wir uns festhalten können.
Allerdings sind Prozesse in der Gruppe schwerer zu beobachten als die Prozesse während eines Gesprächs im Einzelsetting. Um uns trotzdem zu orientieren, helfen uns Instrumente wie Soziogramme, die die verschiedenen Rollen in einer Gruppe sichtbar machen können. Soll heißen: Welcher Patient übernimmt die Rolle des Alpha, also der sichtbaren Führung, des fortwährend aktiven Sprachrohrs der Gruppe? Wer ist das Beta, die graue Eminenz im Hintergrund, welche Alpha berät, ohne aber selbst ins Rampenlicht zu treten? Welche Patienten sind Gamma, die Mitläufer, die sich in der Gruppe anpassen, um Halt zu finden? Und wer ist Omega – der oder die Ausgestoßene, Sündenbock der Gruppe, wenn die Dynamik zu belastend wird und Patienten ihren Unmut konzentrierend verlagern möchten?
Genau hier zeigt sich, warum es so wertvoll ist, wenn in der Gruppentherapie auch ein Co-Therapeut anwesend ist. Denn der Haupttherapeut hat ja die Aufgabe, den Gesprächsfluss aufrechtzuerhalten, nachzufragen, zu moderieren. Das ist schon an sich viel Arbeit, weswegen da vieles Zusätzliche dem Blick entgleiten kann. Der Co-Therapeut jedoch kann das sehen: Er beobachtet, notiert, nimmt Nuancen wahr… also Momente und Veränderungen, die eigentlich im dynamischen Gesprächsfluss zu oft untergehen.
Denn auch die haben enorme Bedeutung. Du kannst dir sicher vorstellen, wie es zum Beispiel wirkt, wenn neue Patienten in der Gruppe willkommen geheißen werden. Oder wenn Patienten (z.B. aufgrund von Entlassung) die Gruppe verlassen. Ebenso, wenn Therapeuten wechseln. Für die Gruppe bedeutet das insgesamt Unsicherheit, und stellt sogar manchmal einen Bruch in der Einheit dar. Auch für die neuen Therapeuten selbst kann das belastend sein, besonders dann, wenn sich die Gruppe kollektiv gegen „den Neuen“ wendet: Wenn ein Ablehnungsgefühl entsteht, das einem fast wie ein Bündnis gegen die „Autorität“ gleicht!
Besonders spannend sind meiner Meinung ja auch die Fragen, welche die Patienten an die Therapeuten richten!
Zum Beispiel wurde ich von einem Patienten mitten im Gespräch gefragt: „Soll ich meinen Partner heiraten?“
Der Patient wollte definitiv eine klare Antwort von mir, denn in seinen Gesprächen hat er mir schon oft genug von seinem liebevollen, jedoch auch narzisstischen Partner erzählt, der mitunter ein wenig unter Kontrollzwängen leidet.
Aber für mich gab es da definitiv keine klare Antwort. Denn was der Patient fragte, das war für mich nicht bloß eine banale Frage nach einem Ja oder Nein. Das war ein Prüfstein für unsere therapeutische Beziehung. Ein guter Therapeut antwortet hier nicht mit einer Handlungsempfehlung, sondern mit einer Rückfrage: „Warum fragen Sie?“
So wird dem Patienten die Verantwortung für seine weitere Entscheidung nicht abgenommen, sondern die innere Haltung des Patienten wird ins Zentrum unseres weiteren Gesprächs gestellt.
Ein kurzer Hinweis, falls Du trotzdem mal eine klare Handlungsempfehlung gibst, mit der ein Patient nicht einverstanden ist: Natürlich bleibt auch in einer guten Beziehung Platz für Differenz! Ja, manchmal stimmt man schlichtweg nicht überein. Der Patient sagt: „So ist es für mich!“ – und der Therapeut könnte erwidern: „Ich sehe das anders, aber wir können es gerne so übernehmen.“ Allein in dieser Haltung steckt viel: Es ist Respekt, ohne bedingungslose Zustimmung.
Drüber reden oder übelnehmen?
Ein weiteres zentrales Phänomen in der Gruppentherapie ist die Rolle der Mentalisierung. Du kannst dir vorstellen, wie eine Gruppe über eine Stunde zusammensitzt und in dieser Zeit viel Raum hätte für das Aussprechen von Angst, Trauma oder Wahrheit – und doch wird über das Wetter gesprochen. Oder über den letzten Urlaub in Ägypten. Belanglose Themen, scheinbar harmlos, aber in Wirklichkeit oft ein Schutzmechanismus.
Als Therapeut musst Du Dir bewusst machen: Eine Gruppentherapie erfolgreich steuern zu wollen, funktioniert nur teilweise. Die Patienten tun trotzdem, was sie wollen. Das hört sich auf den ersten Blick vielleicht chaotisch oder unproduktiv an, aber genau darin liegt eine Chance. Wobei – und das muss ich anmerken – es wahrscheinlich so ein 50:50-Ding ist.
Einerseits zeigt sich Autonomie: Die unsicheren Patienten steuern sich selbst, treten selbstbewusster auf.
Andererseits ist es eine Form der Vermeidung. Wer die Kontrolle hat, bestimmt das Gesprächsthema und vermeidet schwierige Themen. Vermeidung ist vor allem bei Angstpatienten ein instinktiver Reflex.
Sehr typisch ist auch eine Art inflationäres Loben: „Du bist doch aber wahnsinnig toll und großartig!“ Das hat Patient Y damals lauthals verkündet, als Patient X über seine schwierigen Erfahrungen mit Mobbing im Gymnasium klagte. War das mitfühlend? Ja! Aber an sich war das im Endeffekt ein Ausweichmanöver: Ein Versuch, dem Schmerzhaften die Schärfe zu nehmen, indem man den Patienten mit Zucker überschüttet.
Darum ist es so wichtig, dass Dinge in der Gruppe „richtig“ angesprochen werden.
Vor allem vom Therapeuten: Ja, es ist schwer, weil dann oft Gegenwind entsteht. Manche Patienten reagieren wütend, wenn man „schon wieder“ auf das eigentliche Thema zurückkommt, das sie vermeiden wollen. Aber genau diese Konfrontation ist unverzichtbar. Dieses „Ansprechen“ vom Therapeuten wird als Kränkung verstanden, oder als Entblößung. Das stimmt aber nicht; vielmehr ist es eine ehrliche Rückmeldung.
Aber auch Patienten sollten die Dinge ansprechen, denn dazu ist die Gruppe durchaus in der Lage. Stell Dir vor: Ein Patient berichtet, er habe einen Termin beim Arbeitsamt gehabt, der sei zwar nicht gut gelaufen, aber er habe es „akzeptiert“ und sei danach beim Abendessen nicht wütend gewesen. Darauf meldet sich ein anderer Patient: „Aber das stimmt doch nicht, gestern hast du dich doch ganz anders verhalten?“
Es ist also folgendes passiert: Die Gruppe deckt Unwahrheiten oder Selbsttäuschungen auf. Mal sanft, mal zweifelnd, mal tadelnd – aber in jedem Fall direkt. Wie gut!
Besonders eindrücklich war für mich das Gespräch mit einem eingeborenen Patienten, der über seinen Rassismus sprach. Er erzählte, wie er draußen, mit einer großen Gruppe von 14 Personen, alles Patienten der Klinik, in einer Bar hockte. Da hätte es gutes Bier gegeben, und die Nachos an der Bar sahen auch ganz lecker aus. Aber natürlich hätte jeder nur alkoholfreies Bier oder Radler getrunken, weil ja die ETG-Werte negativ bleiben sollten, solange man sich in stationärer Behandlung befindet.
Wie auch immer, in der Bar hatte sich die Patientengruppe gegenseitig hochgeschaukelt: „Alle Ausländer sind Diebe!“ Ein gefährliches Schema, das durch das Gruppenkollektiv verstärkt wurde. Aber drinnen, in der Klinik, zeigte derselbe Patient ein anderes Verhalten: Auf Nachfrage gestand er, aus Hunger schon öfter einen zweiten Joghurt aus dem Stationskühlschrank genommen zu haben, der einem anderen Patienten gehörte. Das war jetzt kein großes Verbrechen – aber der Patient war ein Joghurt-Dieb, sozusagen.
Hier prallten dann zwei Wirklichkeiten aufeinander: Draußen, in der großen Gruppe, stigmatisierte der Patient andere als Diebe. Drinnen, im kleineren, therapeutischen Raum, musste er erkennen: Auch in ihm selbst als Eingeborener steckte dieselbe Tendenz. Das brachte sein rassistisch gefärbtes Schema ins Wanken.
Das Beispiel zeigt sehr deutlich, wie unterschiedlich Dynamiken in Großgruppen und Kleingruppen verlaufen. In Großgruppen entsteht eine hohe Kohäsion, ein Drang, extreme Reaktionen zu verstärken. Darum gilt in der therapeutischen Praxis die Regel: Nur kleine Gruppen von sieben bis acht Personen! Hier lassen sich Prozesse akzeptabel steuern, hier bleibt Raum für Differenz – und das Risiko extremer Polarisierung sowie Ablehnung sinkt deutlich.
Symbolbilder © Medicus/Nicolas Bauder.
Alte Regeln, neue Regeln
Hui, das ist vielleicht eines der spannendsten Phänomene in Gruppenprozessen: Nichts bleibt, wie es ist. Schon allein, weil Gruppen ständig in Bewegung sind – selbst wenn deren Mitglieder bloß auf ihren Stühlen sitzen. Manche Patienten werden entlassen, neue kommen dazu – und plötzlich verändert sich das Gefüge. Was gestern galt, ist morgen vielleicht schon Geschichte.
Man darf sich das wie eine unsichtbare Verfassung vorstellen, die jede Gruppe für sich entwickelt. Zunächst herrscht eine „alte Ordnung“: Das sind bestimmte Regeln, die ungeschrieben im Raum stehen und das Miteinander prägen. Doch wenn neue Mitglieder dazukommen, bringen sie ihre eigenen Vorstellungen, Werte und Verhaltensmuster mit. Vielleicht finden zwei dieser „Neuen“ die alten Regeln nicht sinnvoll oder gar richtig dumm. Diese zwei schließen sich dann zusammen, ziehen weitere (neue Mitglieder) auf ihre Seite – und ehe man sich versieht, kippt das gesamte System. Das alte Regelwerk wird demokratisch „überworfen“ und durch ein neues ersetzt. Wird das besser sein? Wer weiß! Nichtsdestotrotz ist es ein Ausdruck der lebendigen Dynamik, die Gruppen immer wieder neu formatiert.
Für Dich als Therapeut bedeutet das: Du musst diese Prozesse im Blick behalten. Auch diese stillen Regeln, die man nur mit dem geistigen Auge liest! Denn die Gruppe von letzter Woche ist nicht dieselbe wie heute. Immerhin gab es in den letzten sechs Tagen vier Aufnahmen und vier Entlassungen! Mit jedem Wechsel kann sich das Soziogramm in der Gruppe verschieben. Alpha, Beta, Gamma, Omega – die Rollen verteilen sich neu, sobald das Gebilde ins Wanken gerät.
Und dann gibt es noch die Frage nach der Gruppenfähigkeit. Was passiert, wenn jemand von den anderen als „nicht gruppenfähig“ wahrgenommen wird? Schnell geraten solche Personen ins Abseits. Sie schließen sich nicht an, sie wirken zu mäuschenhaft, zu eigenartig, zu störend. Oder vielleicht ziehen sie unverhältnismäßig viel Aufmerksamkeit auf sich? Häufig rutschen diese Patienten in die Omega-Rolle, werden zu Außenseitern oder Sündenböcken degradiert. Es ist dieser stille Prozess der Abgrenzung, der in Gruppen wie von selbst geschieht.
Ein bisschen zu viel von allem
Am Ende läuft vieles auf die Stärkung des Patienten hinaus. Das Ziel ist nicht, jemanden „umzuformen“ oder an ein abstraktes Ideal anzupassen, dass man im Buch auf Seite 275 als „Soll-Zustand“ kennengelernt hat.
Nein, Du solltest ihm helfen, mit sich selbst und mit der Welt besser zurechtzukommen. Das heißt: Frustrationstoleranz aufbauen, Motivation fördern, die Fähigkeit stärken, Ambivalenzen auszuhalten… das sind die eigentlichen Errungenschaften der Gruppentherapie. Denn das Leben ist nun einmal nicht einfach, es ist voller Gegensätze, Brüche, Spannungen. Ich würde sagen: Es ist ein Mix aus fragilem Mosaik und leckeren Pralinen aus einer weißen Schachtel mit gelber Schleife.
Gerade darum ist es wichtig, dass der Patient lernt, nicht alles als feindseligen Akt zu interpretieren. Mach dem Patienten deutlich, dass er kein Spion im Feindesland ist! Und ein einzelner Blick aus dem Fenster während einer Sitzung ist keine Kriegserklärung! Diese Differenzierungen sind entscheidend.
Im Übrigen hilft es auch als Therapeut nicht, in kindlicher Weise zum Patienten zu sagen: „Sie sind toll und großartig.“
Ja, Mitmenschlichkeit ist wichtig, aber sie reicht nicht. Das wirkt in der Therapeut-Patient-Beziehung eher wie ein Trostpflaster. Definitiv nicht wie ein Heilmittel. In der Kindheit auf der Geburtstagsfeier mag das schön noch klingen, aber in der Erwachsenentherapie braucht es mehr. Es braucht Fachlichkeit, Methoden, evidenzbasierte Standards. Dein Bauchgefühl allein ist zu wenig. Freilich ist blankes Fachwissen oder reine Psychoedukation ebenfalls zu wenig. Bloß Schwätzen hat noch nie jemanden geheilt.
Darum ist es sinnvoller, das Vermeidungsverhalten in der Therapie direkt in den Blick zu nehmen. Das bedeutet, nicht einfach nur einen Kommentar abzugeben („Sie machen das gerade schon wieder…“), sondern das Vermeidungsverhalten aktiv anzusprechen. Du solltest den Patienten dazu bringen, selbst darüber nachzudenken, warum er gerade jetzt etwas vermeidet oder warum er sich in der Gruppe so verhält. Frag den Patienten: „Trauen Sie sich, darüber nachzudenken, warum Sie in diesem Moment etwas vermeiden wollen?“ Oder: „Hinterfragen Sie sich einmal selbst, warum Sie in der Gruppe so vermeidend reagieren?“ Solche Fragen wirken stärker als jeder oberflächliche Kommentar – der Patient wird durch Dich zum Reflektieren gebracht. Und im besten Fall zur Einsicht.
Dazu sei gesagt: Wie Du das genau ansprichst, steht nicht eins zu eins im evidenzbasierten Handbuch. Man kann tausende Seiten lesen – über Interventionen, über psychodynamische Techniken, über Skills… Doch am Ende hilft Dir kein Schema, wenn du nicht auch Feingefühl und Bauchgefühl entwickelst, wann ein Satz trifft und wann er verletzt.
Und zugleich bleibt die Haltung zur Literatur selbst eine Herausforderung. Will man sich wirklich durch Otto Kernbergs fachbegrifflich dichtes, zwölfbändiges Werk in all seinen Facetten durchkämpfen, um die histrionische Borderlinerin aus Zimmer 2.03C während der DBT-Gruppe besser nachvollziehen zu können? Vielleicht ja, vielleicht nein. Die Bücher mögen Dir Orientierung geben, aber diese Leitlinien ersetzen nicht den lebendigen Moment in der Therapie. Denn genau dort, im Zusammenspiel von Regeln, Fachwissen, Bauchgefühl und Beziehung, entscheidet sich, ob Veränderung passieren kann.
Der Essay entstand nach einem Gespräch mit Prof. Dr. Gerhard Reister, Oberarzt am Zentrum für Psychosomatik in Calw. Er war ein großartiger Anleiter, und seine Worte erinnerten mich stark an den argentinischen Psychotherapeuten Jorge Bucay. Der Text versucht, die Erzählweise von Prof. Dr. Reister einzufangen – ich habe mein Bestes gegeben, aus meinen Notizen zu seinem Diskurs während einer ärztlichen Supervision einen zusammenhängenden Essay zu gestalten.
Ganz liebe Grüße!
Nicolas Bauder
Symbolbilder © Medicus/Nicolas Bauder.
_____________________
Genderhinweis: Allein aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
_____________________

Nicolas Bauder
Chefredakteur