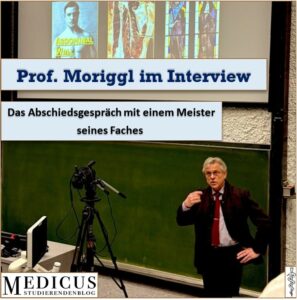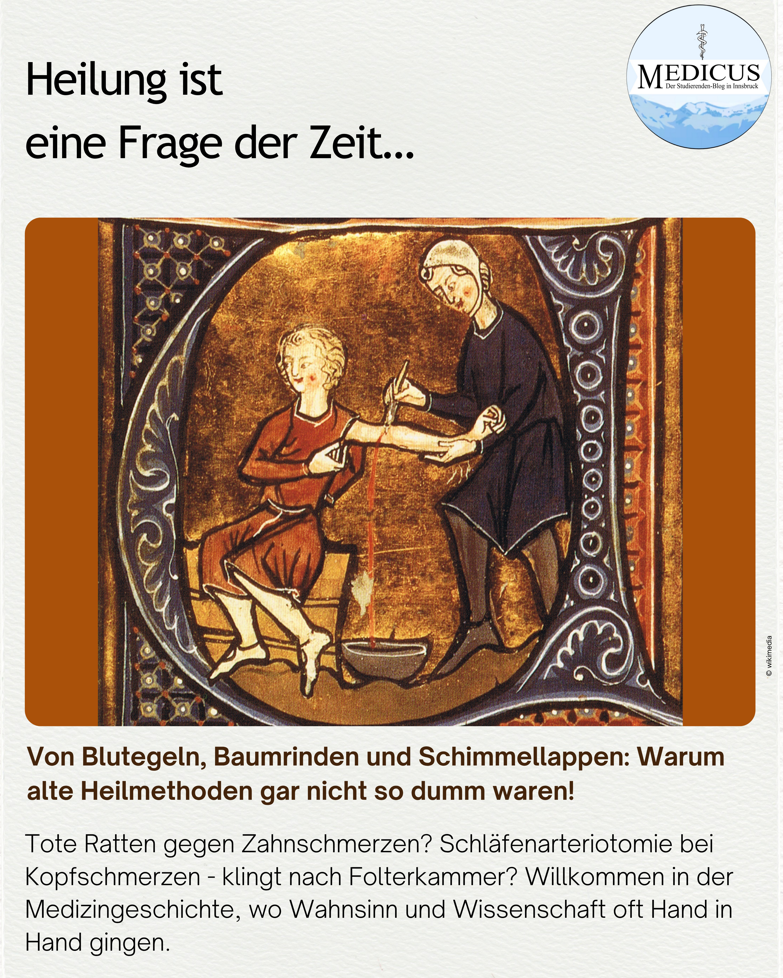
Heilung ist eine Frage der Zeit…
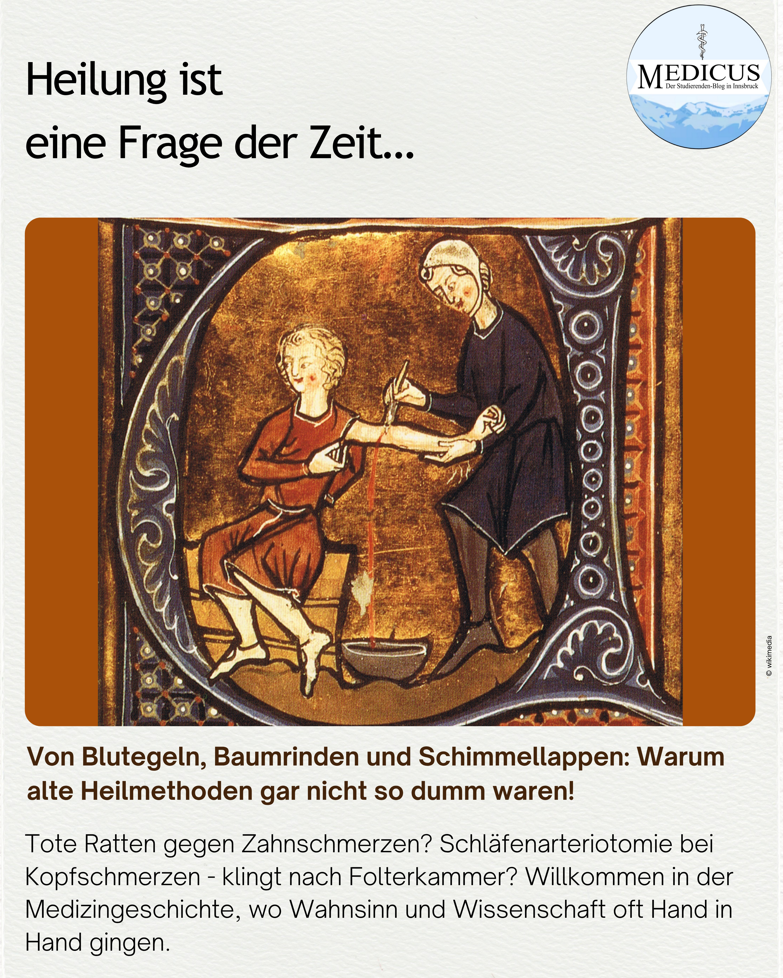
Kennt ihr das, wenn ihr um zwei Uhr morgens auf Instagram doomscrolled und plötzlich ein Minecraft Video auftaucht, bei dem im Hintergrund ein gruseliger Soundtrack läuft und eine AI generierte Stimme erklärt, dass sich früher Leute tote Mäuse in den Mund steckten, um Zahnschmerzen zu lindern? Nein? Naja…Lucky you, ich hätte auch gut damit leben können, ohne davon zu wissen. Aus heutiger Sicht ist eine solche Behandlung ja absoluter Schwachsinn… Aber es muss doch einen wissenschaftlich nachweisbaren Grund geben, dass sich bestimmte medizinische Behandlungsformen in den Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte etabliert haben, oder?

Aderlass. © wikimedia.
Blutige Angelegenheit oder “Let It Bleed”
Eines der ältesten Heilverfahren, die wir kennen und sogar heute noch benutzen, ist der Aderlass, oft auch Phlebotomie genannt (altgr: phleps…Ader, tomie…Schnitt). Über die genauen Ursprünge des Aderlasses ist wenig bekannt, doch wir wissen, dass dessen Anwendung in der Antike auf der Krankheitslehre der Körpersäfte beruhte.
Um damals die Krankheit, also das Ungleichgewicht oder die falsche Vermischung dieser Säfte zu behandeln, mussten diese aus dem Körper ausgeleitet werden. Unterschieden wurde dabei zwischen zwei Verfahren: Derivation und Revulsion. Während bei der Derivation mit großen Blutmengen die verdorbenen Säfte direkt in der Nähe der erkrankten Region entfernt wurden, galt es bei bei der Revulsion mit kleinen Blutvolumen an weit entfernten Stellen dafür zu sorgen, dass die “schlechten Säfte” den Körper verließen, während die “guten Säfte” den Körper stärkten.
Die Phlebotomie war schon früh eine sehr exakte Wissenschaft und galt lange als Wundermittel für sämtliche Krankheiten. Für jede Krankheit gab es eine bestimmte Vene oder Arterie, an der das Blut ausgeleitet werden sollte, einen perfekten Zeitpunkt (der natürlich anhand der Sterne bestimmt wurde), das richtige Werkzeug (mit dem unheilvollen Namen “Aderlassschnäpper”) und natürlich eine ausgebildete Person, welche den Eingriff durchführen konnte.
Viele von euch haben gerade den letzten Satz noch einmal lesen müssen. Vielleicht weil ich dazu neige, zu lange und unnötig verschachtelte Sätze zu fabrizieren, aber vielleicht auch um zu prüfen, ob da gerade wirklich geschrieben stand, dass Arterien eröffnet wurden, um Blut abzuleiten. Kurze Antwort: Ja. Lange Antwort: Galenos von Pergamon verordnete Arteriotomie an den Schläfenarterien bei chronischen Kopfschmerzen. Cheers!
Später, im Mittelalter, war der Aderlass nicht mehr Sache von Ärzten und Chirurgen, sondern von Barbieren. Warum? Lassen wir doch Henri de Mondeville, Wundarzt und Lehrer der Anatomie in Montpellier um 1300, zu Wort kommen: “Da sie ihn für unter ihrer Würde hielten, haben Ärzte den Aderlass seit langer Zeit den Chirurgen überlassen. Später haben die Chirurgen diese Operation aus folgenden Gründen den Barbieren überlassen: 1., weil sie wenig einbringt, 2., weil sie eine unwichtige und leicht auszuführende Operation ist.”
Wie viel Blutvolumen genau bei einem Aderlass entnommen wurde, variierte über die Jahrhunderte nicht nur je nach Krankheit, sondern natürlich auch nach Überzeugung des behandelnden Arztes. Man kann davon ausgehen, dass das Volumen durchschnittlich wohl zwischen 50 und 1000 ml lag. Es gibt Quellen, die berichten, dass Leonardo Botallo, auch “König der Aderlasser”, um 1550 versuchte, Tuberkulose durch die Entnahme von zwei bis drei Litern Blut zu heilen…
Heute wissen wir, dass Krankheiten nicht aus einem Ungleichgewicht der vier Körpersäfte entstehen, und nur bei wenigen Krankheiten spielt der Aderlass heute noch eine Rolle. Meist geht es heutzutage darum, z.B. hohe Hämatokritwerte (wie bei der Polycythaemia vera) oder hohe Eisenwerte (bei der Hämochromatose) zu senken.
Schauen wir kurz zurück auf unsere ursprüngliche Fragestellung: gibt es einen wissenschaftlichen Grund, welcher den Aderlass als Heilmittel legitimiert? Naja, nichts Fixes. Man nimmt an, dass häufiges Aderlassen eine vorübergehend blutdrucksenkende Wirkung bei Hypertension hat, allerdings wurde diese Beobachtung noch nicht durch ausreichend große, randomisierte Studien überprüft. Hinzu kommt, dass manche Bakterien, wie zum Beispiel Yersinia pestis, in eisenarmen Umgebungen schlechter gedeihen und Aderlass so eventuell positiv den Verlauf bestimmter Infektionskrankheiten beeinflussen könnte. But let’s be real: Meistens schwächt der Aderlass die Patienten mehr, als dass er ihnen hilft.

Silber-Weide: Salicin ist ein Stoff, der in Weidenrinde (Salix) vorkommt. Er ist ein natürlicher Vorläufer von Salicylsäure, dem Hauptwirkstoff von Aspirin, und hat schmerzlindernde, entzündungshemmende und fiebersenkende Eigenschaften. © wikimedia
Baum der Götter oder “Sweet Bark O’Mine”
Salix purpurea, Salix alba, Salix caprea…Klingt episch, oder? Es handelt sich dabei tatsächlich um eine antike Superheldin: die Weide. Heute kennen wir sie von gemütlichen Sonntagsspaziergängen im Park oder wegen ihrer „Palmkatzler” für die Palmstangen vor Ostern. Aber bei den alten Griechen war sie als gottgesandte Heilerin für sämtliche Leiden bekannt. Plinius der Ältere beschrieb in seiner Naturalis historia: “…der Saft fördert die Harnausscheidung und entfernt alle Eiterherde im Innern des Körpers…die Blätter hemmen im Getränk eingenommen unmäßigem Geschlechtstrieb und beseitigen ihn ganz, wenn man sie öfter trinkt…die Frucht (das Weidenkätzchen) vor der Vollreife hilft gegen Blutspeien…die Asche der Rinde mit Wasser vermischt heilt Hautschwielen…die Asche der Rinde mit dem Saft vermischt heilt Hautflecken im Gesicht…die Blätter der Dotterweide lindern, wenn man sie auf die Stirne legt, Kopfschmerzen…der zur Blütezeit gewonnene Saft dient zur Reinigung von all dem, was den Augen hinderlich ist.”
Ein Baum übernimmt die Aufgabe einer gesamten Apotheke!
Während in der Antike noch Saft, Blatt und Frucht als Heilmittel Verwendung fanden, stieg in späteren Jahrhunderten vor allem die Bedeutung der Weidenrinde mit ihrer fiebersenkenden und schmerzlindernden Wirkung. Vor allem im Mittelalter durfte Weidenrinde in keiner Hausapotheke fehlen. Egal ob als eine Art mittelalterlicher Kaugummi gegen Fieber, oder als wohltuender Tee gegen Zahnschmerzen: Weidenrinde war zugänglich für alle und unkompliziert zu ernten.
Mit der Entwicklung der Medizin im 16. und 17. Jahrhundert verlor die Weidenrinde als natürliches Medikament an Bedeutung und ihre medizinische Verwendung geriet in Vergessenheit. All ihre Aufgaben wurden von der bitteren Chinarinde übernommen. End of the story? Auf keinen Fall! The best is yet to come…
Die Chinarinde war auch sehr effektiv bei der Bekämpfung von Fiebern und Infektionen…es gab nur ein kleines Problem: Chinarinde musste importiert werden, was wiederum die Preise in die Höhe schnellen lies. Als kleiner Vergleich: um 1747 kostete ein Loth Chinarinde etwa 80 Kreuzer. Einheimische Rinden wie die Eschenrinde ein Kreuzer pro Loth (Unter einem Loth kann man sich ungefähr ein „Löffel voll“ vorstellen, also zwischen 14,5g und 16,5g.).
Es musste eine Lösung her!
Mehrere europäische Gelehrte wandten ihre wissenschaftliche Neugier erneut der Weide zu, und tatsächlich: Ihre Forschung bestätigte, dass die Weidenrinde die gleiche Wirkung wie die Chinarinde manifestierte (wenn auch nicht immer im selben Ausmaß). Ab dem 19. Jahrhundert war die Weidenrinde wieder in allen amtlichen Arzneimittel-Büchern als fiebersenkendes Mittel aufgeführt.
1828 gelang es dem Deutschen Johann Andreas Buchner und ungefähr zeitgleich dem Franzosen Pierre-Joseph Leroux erstmals Salicin, einen chemischen Verwandten der Acetylsalicylsäure (ASS), aus der Weidenrinde zu isolieren. Wenig später konnte Salicylsäure bereits synthetisch hergestellt werden, und ca. 70 Jahre später war Aspirin als Medikament gegen Schmerzen und Fieber auf dem Markt.
Heute wird Weidenrinde nicht mehr in Form von unappetitlichen Abkochungen aus dem Wald getrunken. Aber die Wirkstoffe sind immer noch ein fester Bestandteil vieler Medikamente, die wir als „Schmerzmittel“ kennen. Der Vorteil von Weidenrinde gegenüber modernen synthetischen Schmerzmitteln? Sie wirkt oft sanfter und langsamer, was sie besonders für Menschen mit chronischen Schmerzen oder Entzündungen nützlich machen kann. Ein bisschen wie die „Urgroßmutter“ der modernen Schmerzmittel.

Schimmel. © Pferdewiki
Schimmelige Lappen oder “The Mold That Heals”
Viele von uns kennen die Geschichte: Alexander Fleming vergisst 1928 vor den Sommerferien eine Agarplatte mit Staphylokokken an seinem Arbeitsplatz. Als er im Herbst zurückkommt, entdeckte er, dass auf dem Nährboden ein Schimmelpilz wuchs, in dessen Nachbarschaft die Bakterien sich nicht vermehrt hatten. Et voila: Antibiotika! Aber Fleming war bei Weitem nicht der Erste, der die antibiotisch wirksamen Substanzen mancher Pilze entdeckte. Tatsächlich machten sich schon tausende Jahre vor Christus die Nubier und alten Ägypter diese Eigenschaften zunutze. Ägyptische Heiler fertigten aus Gerstenbrei Umschläge, mit welchen infizierte Wunden behandelt wurden. Das Besondere? Das Brot darin ließen sie vorher absichtlich verschimmeln. Eine weitere Methode, welche die Ägypter und Nubier benutzten, um den heilsamen Schimmel herzustellen, war die unterirdische Lagerung von Hirse, die zum Bierbrauen verwendet wurde. Bei dem dabei entstandenen Antibiotikum handelt es sich allerdings nicht um Penicillin, sondern um Tetracyclin. Heute wird dieses vor allem gegen Akne eingesetzt.
Auch arabische Reitervölker waren sich der heilsamen Wirkung von Schimmel bewusst: Die Stallburschen bewahrten die schweren Sättel an warmen, feuchten Orten auf, wo sich verschiedene Schimmelpilze leicht ansetzen konnten, und verhinderten so manche schwere Infektion von Scheuerstellen nach langen Ritten. Zur Zeit der alten Griechen züchteten Ärzte und Heiler Schimmelpilze auf speziellen Nährböden aus Honig und Schafskot, um dann die schimmligen Lappen auf die Wunden zu legen. Let’s be real, ziemlich eklig, oder? Die Behandlung mit Schimmelpilzen mag in der Vergangenheit sicher so manches Leben gerettet haben, aber nicht alles war an dieser Methode vorteilhaft. Was damals als „Heilmittel“ galt, hat sich aus heutiger Sicht eher als ein Experiment aus der Kategorie „Das sollte man vielleicht nicht tun“ herausgestellt. Schimmliges Brot ist nicht nur eine potenzielle Quelle von nützlichen Schimmelpilzen, sondern auch von gefährlichen Krankheitserregern. Viele Schimmelpilze produzieren Toxine, die in offenen Wunden nicht unbedingt förderlich für den Heilungsprozess sind. Statt einer wunderbaren Wundheilung riskierte man eine schwere Infektion oder eine toxische Reaktion.
~
Heutzutage sind wir in der Medizin glücklicherweise etwas weiter als in den Zeiten des schimmligen Brotes auf der Wunde. Statt uns mit potenziellen Krankheiten aus den Tiefen der Küche zu infizieren, greifen wir auf moderne, wissenschaftlich fundierte Methoden zurück. Heute setzen wir auf moderne Antibiotika und antiseptische Salben, die nachweislich wirksam sind und keine Überraschung in Form von Schimmelpilz-Toxinen mit sich bringen. Bei der Wundbehandlung geht es heute darum, eine saubere, keimfreie Umgebung zu schaffen – was uns von der „Brot-und-Schimmel-Therapie“ der Vergangenheit klar entfernt hat.
~
PS: Das Zitat aus dem Titel wird Hippokrates zugeschrieben und lautet: “Healing is a matter of time, but it is sometimes also a matter of opportunity. However, knowing this, one must attend to medical practice not primarily to plausible theories, but to experience combined with reason.”
Lame but true…die Untertitel sind natürlich an berühmte Songs angelehnt: Let It Be (The Beatles), Sweet Child O’Mine (Guns’n’Roses) The Thing That Should Be (Metallica)

Maria Rinina
Chefredakteurin