
Interview mit Frau Dr. Kathrin Sevecke

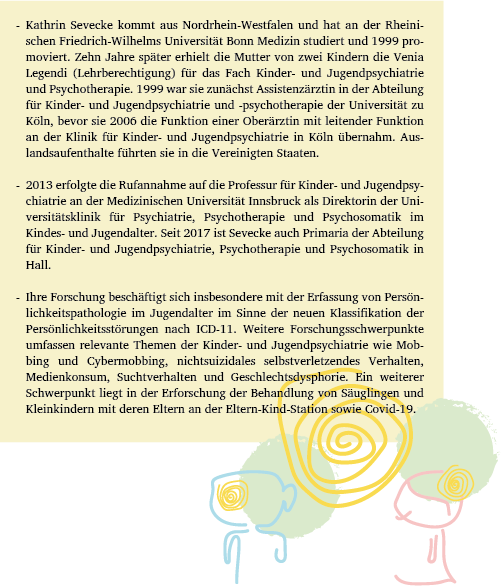
Gibt es ein spezifisches Erlebnis, das Sie dazu verleitet hat, Kinder- und Jugendpsychiaterin zu werden?
Es gibt eher ein Nicht-Erlebnis: Für mich gab es in der Medizin sonst kein geeignetes Fach. Operieren ist nicht meins. In der Pädiatrie war es mir eher zu fad, immer körperliche Erkrankungen über kurze Zeit zu behandeln. Ich vermutete teilweise andere, eher psychische Auffälligkeiten bei den Kindern zu sehen, aber diese wurden nicht thematisiert und die Kinder sind dann auch immer relativ schnell aus der Klinik entlassen worden. In der Erwachsenenpsychiatrie war für meinen Geschmack die Krankengeschichte zu lang, es erschien mir als Studentin und junge Ärztin auch nicht „so lebendig“.
Deshalb war ich dann sehr froh, dass ich das Fach Kinder – und Jugendpsychiatrie entdeckt habe, obwohl es in Bonn an meinem Studienort keinen Lehrstuhl dafür gab und daher auch nicht eigens unterrichtet worden war. Ich bin durch Zufall darauf gestoßen und seitdem bin ich überzeugt gewesen, dass es genau das richtige Fach für mich ist.
Also kein Erlebnis, sondern eher das Gefühl, dass ich in genau diesem Bereich richtig bin. Mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten macht großen Spaß und hält außerdem jung.
Und wann sind Sie im Studium mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Berührung gekommen?
Eigentlich erst gegen Ende des Studiums. In Bonn wurde eine neue Klinik eröffnet, die ein Lehrkrankenhaus war – so ein bisschen vergleichbar mit Hall. Dort konnte man famulieren und das praktische Jahr machen. Mir gefiel das Fach so gut, dass ich sogar meine Doktorarbeit über Drogen konsumierende Jugendliche geschrieben habe.
Was ist denn dann der große Unterschied zwischen der Behandlung von Erwachsenen der Behandlung von Kindern und Jugendlichen in der Psychiatrie?
Die Techniken in der Psychotherapie sind anders, da man mit einem Kind anders als mit einem Erwachsenen redet und kommuniziert. Bei Erwachsenen ist die Therapie nämlich vor allem gesprächsbasierend.
Weiters arbeiten wir in der Kinder- und Jugendpsychiatrie nicht nur mit unseren Patient:innen, sondern immer mit dem gesamten Netzwerk: Familie, Ansprechpersonen, Partner:in des/der Patient:in, Schule, Heim, Jugendamt. Das ist ganz einzigartig in der Medizin.
Die medikamentöse Therapie spielt einen deutlich geringeren Stellenwert, würde ich sagen. Wir versuchen Medikamente zu vermeiden bzw. nur dann zu geben, wenn sie auch sinnvoll sind.
Ein weiterer Unterschied liegt in der Vielfalt der Therapieformen (neben der Einzeltherapie), die es so in der Erwachsenenbehandlung nicht unbedingt gibt: Spieltherapie, Familientherapie, Hundetherapie (bei Angststörungen oder sozialen Phobien eingesetzt), Klettertherapie, Pferdetherapie (bei essgestörten Patient:innen oft sehr sinnvoll), Physiotherapie, Ausflüge, Kunsttherapie, Ernährungberatung…
Für mich persönlich kann ich sagen, dass es eine große Freude ist, sich mit lebensfreudigen, lustigen Kindern auseinanderzusetzen.
Denken Sie, der mentalen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen wird genug Beachtung geschenkt? Was könnte man besser machen und wie?
Ich denke, dass der mentalen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen nicht genug Beachtung geschenkt wird. Zwar empfinde ich, dass eine stetige Verbesserung vorherrscht und dass es immer mehr zum Thema wird, aber man muss noch viel für die Sichtbarkeit der mentalen Gesundheit in der Gesellschaft machen.
Entstigmatisierung ist dabei ein großes Thema – dass es sozusagen „salonfähig“ ist, über psychische Erkrankungen zu sprechen. Aktuell ist es den Jugendlichen und Kindern immer noch oft peinlich, teilweise möchten die Familien nicht, dass gesagt wird, dass die Kinder hier (in Hall) sind, stattdessen erzählen die Familien ihre Kinder seien „auf Kur“, was dann die Jugendlichen wieder zerreißt.
Ich persönlich würde sehr gerne auch gesundheitspolitisch Werbung dafür machen, ein Fach wie mentale Gesundheit in den Schulen einzuführen und zwar konkret jedes Schuljahr durchgehend ab der ersten weiterführenden Klasse. Damit regelmäßig über folgende Themen wie mentale Gesundheit, Schulstress, Mobbing, Essstörung, Depression, Schlafstörung gesprochen wird.
Ich würde es auch sehr sinnvoll finden, zusätzlich zu den bisherigen Vorsorgeuntersuchungen auch einen Check der psychischen Gesundheit einzuführen.
Insgesamt soll vom Gesundheits- und Schulsystem sowie sozialem System der mentalen Gesundheit mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, damit die Gesellschaft dann auch offener ist und nicht verurteilt, „der muss in die Klinik, in die Lala Ranch usw.“
Gibt es Gespräche dazu, sowas einzuführen?
Ja, also es gibt Gespräche mit dem Land, mit der Gesundheitsdirektorin, mit der Politik, mit dem Bildungsministerium österreichweit. Es gibt Signale und Bereitschaft, dass es als wichtig angesehen wird. Umgesetzt ist es noch nicht.
Denken Sie, mentale Krankheiten werden in den Medien (Filme, Serien) und auf Social Media realistisch dargestellt? (13 reasons why, never have i ever, big mouth, Atypical, Bojack horseman, Heartbreak high,…)
Ich finde, dass sie überzeichnet und einseitig dargestellt werden. Social Media ist ein guter Kanal, um Jugendliche zu erreichen, aber ich würde mir mehr passend herübergebrachtes Fachwissen vorstellen. Ich erlebe zur Zeit, dass es Jugendliche gibt, die es „schick“ finden, einen Tick zu haben, weil sie Tourette in einer Serie oder aus Social media gesehen haben, oder es ist auch „schick“ manisch depressiv zu sein. Da gibt es viel Nachahmungscharakter, weil es in einigen Serien eben einseitig und überspitzt dargestellt wird und eben nicht nüchtern und faktenbasiert.
Weil das jetzt auch gerade dazu passt: Welchen Einfluss hat die Verbreitung von TikTok auf „Selbstdiagnosen“ Jugendlicher und wie diese ihre mentale Gesundheit wahrnehmen?
Also ich kann es nicht auf Tiktok zurückführen, aber es hat sich auf jeden Fall etwas verändert, da man im Internet sehr vieles finden kann. Es ist für uns dann auch sehr wichtig, das mit zu bedenken, und die Patient:innen auch zu fragen, ob sie über ihre Krankheit schon etwas gelesen haben zum Beispiel im Internet oder Fragebögen online ausgefüllt haben und jetzt überzeugt sind, eine bestimmte Diagnose zu haben. Und da erlebe ich dann beides: Auf der einen Seite sind sie sehr erleichtert, wenn man sagt, es ist nicht die Diagnose, die sie sich selbst gegeben haben, auf der anderen Seite hängen sie ganz eng an der Diagnose, sind überzeugt, dass sie das haben müssen, und dass wir falsch liegen. Genau das ist dann manchmal therapeutisch schwierig, denn da muss man die Frage stellen, warum hängt der/die Patient:in so sehr an dieser einen Diagnose, und was fasziniert, identifiziert ihn damit und wofür steht das eigentlich.
Wie kann man sich Persönlichkeitsstörungen bei Kindern vorstellen, bzw. Wie oft sind diese genetisch/angeboren und wie oft von z.B.Traumata ausgelöst?
Nur angeboren sind sie nicht, es ist immer eine multikausale Ursache: Umfeld, Familie, Umgebung, Traumata können auch eine Rolle spielen, müssen aber nicht, es ist auch ein Teil vererblich. Bei Kindern kommen Persönlichkeitsstörungen selten vor, eher in Richtung Jugend und dann liegt es auch daran, in welchem Umfeld sie sich bewegen und in welchem sie aufwachsen, welche Einflüsse es gibt und inwiefern sie auch eine stabile Identität und Selbstwertgefühl ausbilden können.
Von der Symptomatik einer solchen Störung kann man es sich so vorstellen: Es gibt sehr viele Stimmungsschwankungen zum Beispiel eine innere Unruhe, das Gefühl, selber keinen festen Boden unter den Füßen zu haben, ein fehlendes Gefühl – dass man wichtig ist, man geliebt und aufgefangen wird -, ein Gefühl alleine und ohne Freundeskreis zu sein. Aus diesem Gefühl bzw innerem Druck kann es zu Selbstverletzungen wie schneiden, ritzen etc. Kommen. Machnmal können sich auch Suizidideen oder Suizidgedanken entwickeln.
Also gibt es das nicht, dass es in Familien gehäuft vorkommt?
Doch, zum Beispiel gibt es gehäufte Suizidalität in Familie oder auch gehäufte Depressionen. Aber es ist nicht immer nur der genetische Anteil. Das weiß man aus Zwillingsstudien. Denn unter verschiedenen Aufwachsbedingungen sind auch die Verläufe anders. Aber ja, es gibt einen genetischen Anteil, dieser ist allerdings von psychischer Störung zu psychischer Störung unterschiedlich hoch.
Sie behandeln in der Klinik ja auch Geschlechtsdysphorie. Ab welchem Alter „behandeln“ Sie Patienten und wie sieht das aus?
Grundsätzlich muss man hier verschiedene Verläufe unterscheiden: Wenn es ganz früh beginnt (was durchaus vorkommt) und sich durch das Leben zieht, wird das von den Kindern sehr gut, sehr authentisch, stimmig und richtig beschrieben. Es kommt vor und dafür muss auch die Gesellschaft offen sein. In manchen Familien fällt es Eltern und Großeltern nicht leicht damit zurechtzukommen.
Wir stellen fest, dass dieses Thema aktuell bei den Jugendlichen zunimmt, die nach wenigen Wochen die Überzeugung haben, Trans zu sein. Da sind wir eher zurückhaltender als beim zuvor erwähnten Verlauf. Teilweise steht dieses Gefühl für eine andere Symptomatik, eine schwere Depression oder eine Persönlichkeitsstörung. Da wird vermeintlich die Geschlechtsidentität als Auslöser angesehen, was sie aber nicht ist. Oder es besteht eine Traumatisierung, eine Vergewaltigung, etc. und als Verarbeitung dessen meint der Jugendliche, dass eine Geschlechtsumwandling eine Lösung dafür sei. Und das wäre dann falsch, daher schauen wir bei den Jugendlichen sehr genau hin, wo kommt der Wunsch her, wie beständig ist der Wunsch, durch welche Lebensbereiche zieht er sich durch. Es ist wichtig die Jugendlichen gut zu begleiten und gut zu verstehen.
Wenn man gerne bei Ihnen famulieren möchte, welche Voraussetzungen sollte man mitbringen/was kann man sich erwarten?
Voraussetzung ist einfach nur Offenheit und Interesse am Fach.
Was man sich erwarten kann: Mitgehen bei Visiten, Aktivitäten, Gruppentherapien, Tanztherapie, Klettertherapie oder Hundetherapie, Aufbau des Wochenplans und der genannten Therapien. Wir versuchen den Famulanten und KPJlern sehr viel zu zeigen. Es ist jedoch nicht möglich an Einzeltherapien teilzunehmen.
Ich finde auch ganz wichtig, dass die Studierenden wissen, dass wir hier in Hall eine schöne Klinik mit viel Platz und Freizeitgelände draußen haben.
Mir ist es sehr wichtig, jedem Studierenden das Fach zu zeigen, ich nehme sie auch immer mit in meine Visiten.
Jeder Mediziner/jede Medizinerin sollte mit der Kinderpsychiatrie oder der Psychiatrie im Allgemeinen in Kontakt kommen, damit z.B. alte oder frische Ritzwunden bei Patient*innen zu keiner Überforderung führen. Sie sollen sich als Studierende daran erinnern, dass es so etwas gibt und wie man damit umgeht. Wir als Kinderpsychiater*innen sind eigentlich die letzten, die die Patient:innen sehen. Deshalb bin ich immer ganz überzeugt, dass jeder, der möchte, hier die Möglichkeit haben sollte zu famulieren, und sich das Wissen im Studium mitnimmt. Ich halte das schon für sehr relevant.
Denn die mentale Gesundheit wird Ihnen überall begegnen.
Also finden Sie, es wird in den anderen Fachrichtungen zu wenig Wert auf die mentale Gesundheit gelegt?
Ja, ich wünsche mir, dass die Kollegen uns die Patient:innen früher schicken. Wir kriegen ja Zuweisungen aus Südtirol, Vorarlberg und Tirol und teils wird da zu lange gewartet. Dann hat das Kind zum Beipsiel schon 20kg abgenommen und es wäre schön, wenn es „nur 10kg“ gewesen wäre, es sollte früher auffallen. Die psychischen Erkrankungen nehmen zu und da ist mir wichtig, dass die Kolleg:innen in den Praxen draußen aufmerksamer werden.
Wie schaffen Sie es, die Arbeit nicht „nach Hause zu nehmen“
Zum einen arbeiten wir hier sehr gut im Team miteinander. Es gibt immer die Möglichkeit, schwierige Dinge im Team nachzubesprechen, alles auf verschiedene Schultern zu verteilen. Zusätzlich holen wir uns fachliche Expertise von außen in From von Supervision mit der Möglichkeit, schwierige Fälle zu besprechen, schwierige Situationen nochmal zu reflektieren.
Und ich finde, es gehört dazu, dass man sich einen Ausgleich schafft. Ich bin immer froh, wenn ich von Innsbruck nach Hall und zurück radeln kann. Da hat man eine halbe Stunde Zeit, nochmal nachzudenken und sich vieles nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. In der Klinik ist es ja nicht wie in einer Ambulanz, da verlassen uns die Patient:innen nicht sofort, da kann ich am nächsten Tag noch etwas nachfragen oder um etwas bitten.
Aber wie gesagt, Ausgleich durch Radfahren, was Anderes machen, das funktioniert sehr gut.
Wie lange ist der durchschnittliche Aufenthalt der Patient:innen?
Wir haben einen geschlossenen Intensiv- und Krisenbereich, da behandeln wir Jugendliche mit akuter Selbst- und Fremdgefährdung im Durchschnitt 2-3 Tage.
Insgesamt beträgt unsere Durchschnittsdauer in der Klinik 28 Tage pro Patient*in. Wir haben extrem lange Aufenthalte auf der Essstörung Station. Wenn zum Beispiel 30 kg zugenommen werden müssen, dauert das ein dreivierteljahr oder länger. Auch auf der Kinderstation haben wir manchmal Aufenthalte von 3 Monaten, wenn für den Patient/die Patientin aufgrund ungünstiger, schwieriger, traumatisierender Umstände zuhause eine Einrichtung gefunden werden muss.
Ein Aufenthalt beginnt immer mit Diagnostik und einer therapeutischen Phase. Nach 8 Wochen wird mit dem Patienten/der Patientin und der Familie überlegt, ob es Sinn macht, weiterhin in der Klinik zu bleiben oder ob er in ein häusliches ambulantes Setting entlassen wird.
Wie kann man sich das bei kleinen Kindern vorstellen mit psychischen Erkrankungen, was sind bei ihnen die Gründe?
Die Beschwerden sind im Prinzip die gleichen, aber Kinder zeigen es uns anders. Ein Jugendlicher kann uns zum Beispiel sagen „ich fühle mich als hätte ich eine Decke auf dem Kopf, ich habe keine Kraft mehr für die Schule, es ist mir alles zu viel“. Das Kind somatisiert häufig gerne, also es hat Bauchweh, es hat Kopfweh, ohne eine körperliche Ursache zu haben (da sind wir wieder in der Abgrenzung zur Kinderheilkunde).
Anzeichen beim Kind wären Interessens- und Freudeverlust, es ist nicht mehr mit Spaß bei der Sache, spielt weniger, schläft schlechter, hat mehr Alpträume. Gründe können aber auch eine schwerkranke Mutter, psychische Erkrankungen in der Familie, ungünstige Zustände in der Familie, Gewalt in der Familie aber auch Mobbing in der Schule sein. Corona hat zum Beipsiel viele Schulängste hervorgeholt, also langes Fernbleiben von der Schule, Überforderung mit Homeschooling…

Nora
Chefredakteurin

Sofie
Redakteurin




